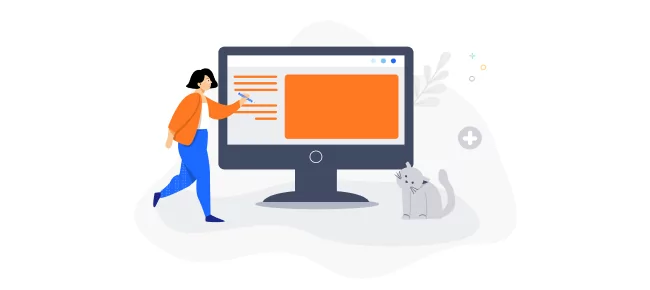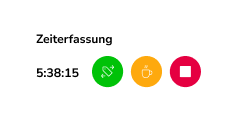EU: Gesetz zur Bekämpfung von Zwangsarbeit in Lieferketten

Die Regierungen der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, die Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CSDDD) zu verabschieden, die Unternehmen dazu verpflichtet, ab dem 15. März 2024 sicherzustellen, dass ihre Lieferketten keine Umweltschäden verursachen und keine Zwangsarbeit stattfindet.
Gemäß des CSDDD-Gesetzes müssen europäische Unternehmen überprüfen, ob importierte Produkte Umwelt- und Menschenrechtsstandards erfüllen, einschließlich des Ausschlusses von Kinderarbeit.
Außerdem müssen sie Maßnahmen ergreifen, um potenzielle Schäden zu verhindern oder zu mindern, und ihre Ergebnisse offenlegen.
Allerdings müssen nur größere Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von mehr als 450 Millionen Euro (384 Millionen Pfund; 489 Millionen Dollar) diese Anforderungen erfüllen. Das ist das Ergebnis von Kompromissen, die während wochenlanger Verhandlungen über den Gesetzentwurf erzielt wurden.
CSDD-Genehmigungsverfahren:
- Die endgültige Fassung des CSDDD-Gesetzes, die am 30. Januar veröffentlicht wurde, schien zunächst leicht akzeptiert zu werden.
- Diese Unterstützung schwand jedoch schnell, als einige Länder den ursprünglichen Text ablehnten, weil sie befürchteten, dass er ihre Industrien, insbesondere ihre vielen kleinen und mittleren Unternehmen, übermäßig beeinträchtigen würde.
- Die Ankündigung Deutschlands, sich der Stimme zu enthalten, veranlasste Frankreich, Italien und andere Mitgliedstaaten, dasselbe zu tun, was bedeutete, dass der Europäische Rat keine Mehrheit für die Richtlinie erreichen konnte.
- Es folgten 45 Tage voller Verhandlungen hinter den Kulissen, Rückschläge und intensiver politischer Druck, was für die Befürworter der Nachhaltigkeit eine turbulente Zeit war.
- Obwohl das CSDDD-Gesetz wiederholt vor Ablauf der Frist am 15. März auf die Tagesordnung gesetzt wurde, zog der Europäische Rat es jedes Mal zurück, als sich abzeichnete, dass es an ausreichender Unterstützung mangelte.
- Die jetzige Verabschiedung des Gesetzentwurfs folgt auf zwei gescheiterte Versuche im Februar, ihn durchzubringen.
- Mit jeder Überarbeitung wurde der Anwendungsbereich der Richtlinie eingeschränkt, doch keine der Vereinbarungen kam zustande.
- Der ursprüngliche Vorschlag zielte auf Unternehmen mit 500 oder mehr Beschäftigten und einem Umsatz von 150 Millionen Euro ab.
- Damit der Gesetzentwurf in Kraft treten kann, muss er nun vom Europäischen Parlament gebilligt werden, was zu erwarten ist.
- Anschließend wird den Unternehmen eine Frist für die Umsetzung der neuen Anforderungen eingeräumt.
Kritik:
- Einerseits haben Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten die Bemühungen zur Stärkung der Unternehmensverantwortung begrüßt, aber auch ihre Enttäuschung über den Gesetzesentwurf geäußert.
- Kritiker sagen, dass das Gesetz stark abgeschwächt wurde und damit nicht mehr richtig funktioniert.
- Laut dem World Wide Fund for Nature (WWF) sind fast 70 % der europäischen Unternehmen aufgrund von Änderungen im Entwurf von den neuen Verpflichtungen ausgenommen.
- Andere Kritiker wiesen darauf hin, dass die neuen Vorschriften beispiellose Verpflichtungen und strenge Sanktionen mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Unternehmen mit sich bringen würden, die weltweit mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert sein könnten.
- Europäische Unternehmen mit globaler Präsenz, von denen einige umfangreiche indirekte Beziehungen unterhalten, könnten gegenüber ihren internationalen Konkurrenten einen Wettbewerbsnachteil erleiden.
- Außerdem wurde die Befürchtung geäußert, dass Unternehmen aufgrund bürokratischer Hürden und rechtlicher Risiken ihren Standort aus der EU verlagern könnten.